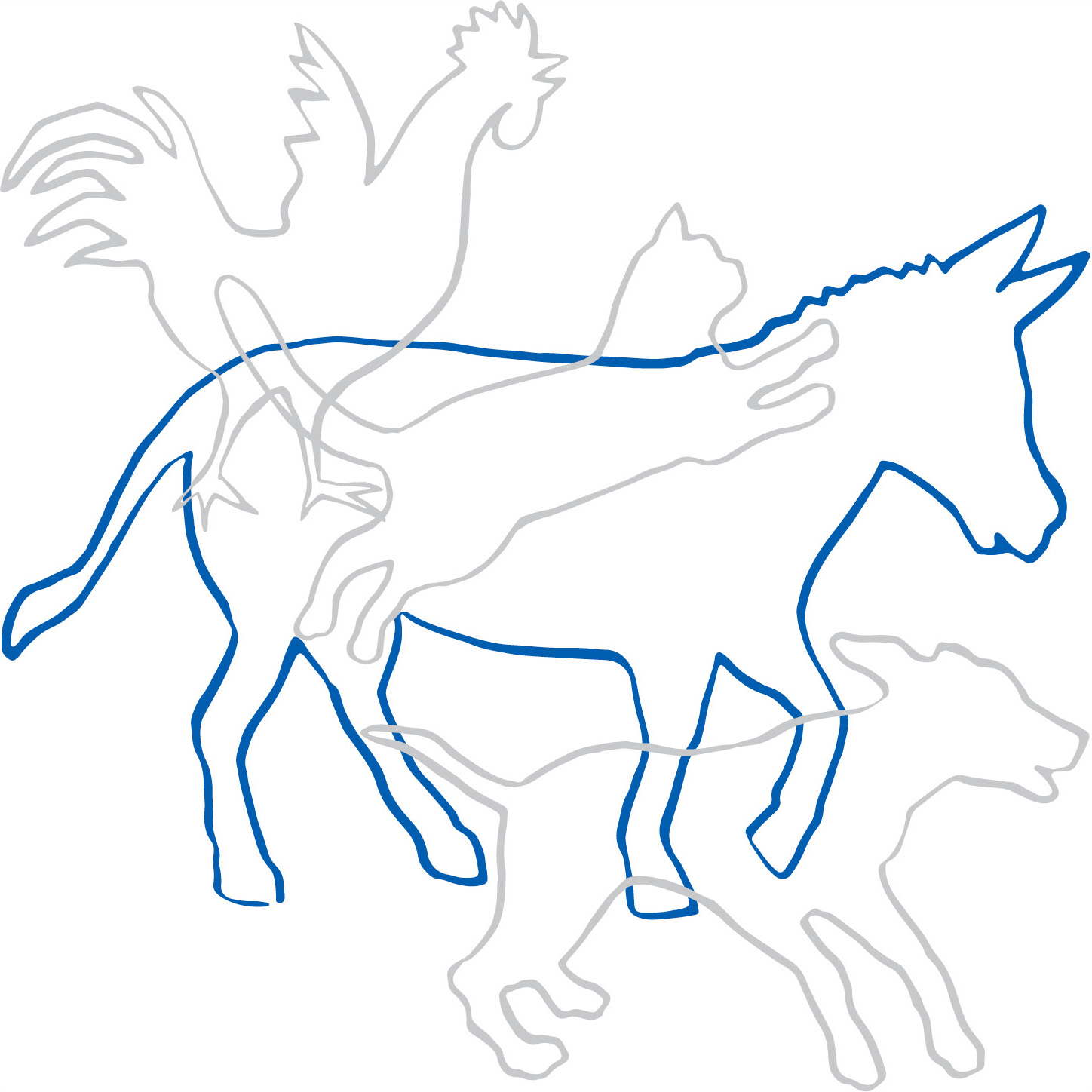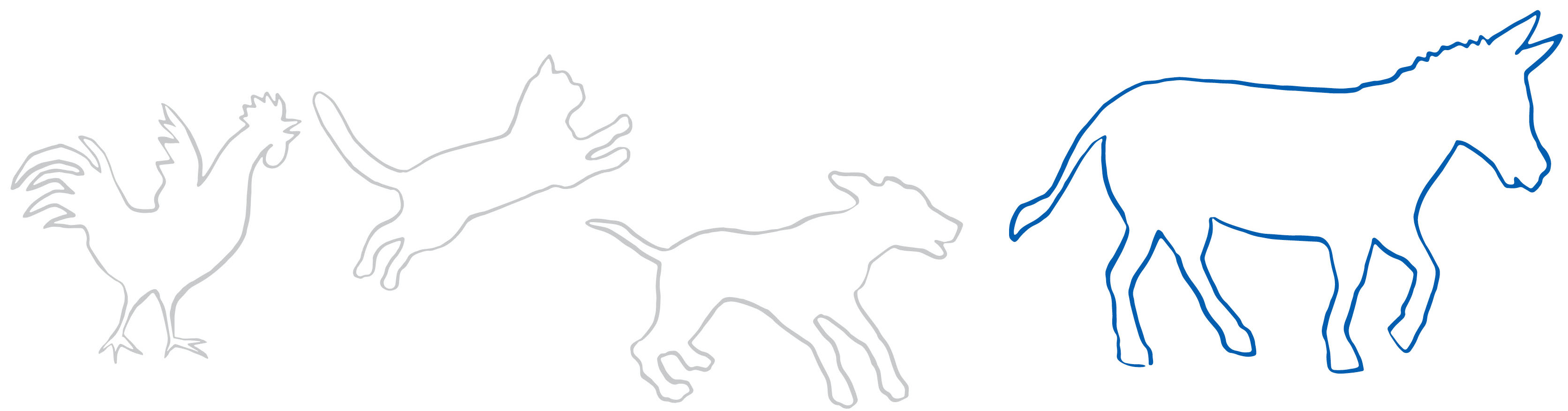Raphaela Dell
Mit einer Kombination aus Psychologie, Organisationslehre und Methoden aus der Welt der Kultur und der Philosophie, befähigt sie Menschen ihr Potential voll zu nutzen.
Mit einer Kombination aus Psychologie, Organisationslehre und Methoden aus der Welt der Kultur und der Philosophie, befähigt sie Menschen ihr Potential voll zu nutzen.
Interesse geweckt?
Schreib uns eine E-Mail, ruf uns an oder nutze einfach unser Kontaktformular.
Macht, Blut und Schuld
Aus meiner Sicht ist Macht kein Bedürfnis. Sie ist ein Instrument, ein Ersatz, eine Strategie – aber kein Selbstzweck. Sie wird oft als Mittel zur Kompensation empfunden, sei es für fehlende Anerkennung, Unsicherheit oder das Streben nach Kontrolle.
Historisch betrachtet zeigt sich dies bei vielen Herrschern, die nicht aus Notwendigkeit, sondern aus innerer Getriebenheit nach Macht griffen – sei es Richard III., der seine Herrschaft durch Manipulation erzwang, oder Macbeth, dessen Machtstreben aus einem tiefen Gefühl der Unvollkommenheit erwuchs. Meiner Meinung nach ergreifen Menschen Macht selten aus reiner Notwendigkeit, sondern weil sie ihnen einen Mangel füllt.
Die Frage ist: Wie gehen jene, die sie besitzen, mit der Verantwortung um, die sie unweigerlich mit sich bringt? Wer trägt Schuld, wer verdrängt sie, wer zerbricht daran?
Wenn ich mir Shakespeares Könige – Heinrich V., Macbeth, King Lear und Richard III. – anschaue, erkenne ich vier unterschiedliche Machtverständnisse, aber eine zentrale Gemeinsamkeit: Ohne einen gesunden Umgang mit Schuld droht entweder der Untergang oder die Entfremdung von der eigenen Menschlichkeit.
Heinrich V. ist der Prototyp des pflichtbewussten Herrschers. Seine Regierungsweise erinnert an historische Herrscher wie Friedrich II. von Preußen oder Augustus, die ihre Macht durch strategische Weitsicht und pflichtbewusstes Handeln legitimierten. Wie diese Herrscher versteht Heinrich, dass Stabilität durch kalkulierte Entscheidungen und gezielte Kommunikation entsteht, und setzt sie gezielt ein, um seine Herrschaft zu festigen. Er strebt nach Macht nicht aus Egoismus, sondern aus einem tiefen Verantwortungsgefühl. Doch dieses Verantwortungsgefühl ist nicht frei von Kalkül.
Er erkennt, dass Macht immer Opfer fordert – und dass diese Opfer mit einer geschickten Narration legitimiert werden müssen. So etwa in seiner berühmten Nacht-vor-Agincourt-Szene: Er hadert mit der Last seiner Krone, aber nicht, weil er sich der Schuld bewusst ist, sondern weil er nach einer Möglichkeit sucht, sie von sich abzuladen. „Jeder Mensch hat seine eigene Bürde zu tragen“, sinniert er – und meint damit, dass auch Soldaten ihre Verantwortung zu akzeptieren haben. Die moralische Schuld seiner Kriegsführung, seiner Todesurteile und politischen Entscheidungen rationalisiert er durch Pflicht. Seine Stärke ist, dass er die Last der Krone anerkennt; seine Schwäche ist, dass er sie nie wirklich reflektiert.
🔹 Schuldmechanismus: Rationalisierung durch Pflichterfüllung
🔹 Strategie: Geschickte politische Kommunikation, Delegation der moralischen Last
🔹 Fallstrick: Gefahr der Selbstentfremdung durch permanente Legitimation der eigenen Entscheidungen
Macbeths Tragödie ist nicht sein Mord an Duncan – es ist seine Unfähigkeit, mit der Schuld umzugehen. Während Heinrich V. seine Verantwortung externalisiert, lastet Macbeth sich seine Schuld selbst auf – doch anstatt eine gesunde Form der Bewältigung zu finden, verfällt er in eine Spirale aus Angst und Gewalt. Seine Psyche wird von seinen Taten zerfressen, was in seiner berühmten "Morgen, Morgen und wieder Morgen"-Rede kulminiert (Akt 5, Szene 5). Während Heinrich V. sich durch Rationalisierung von seiner Schuld distanziert, wird Macbeths Leben durch seine Schuld bestimmt – bis sie ihn vollständig zerstört." Während Heinrich V. seine Verantwortung externalisiert, internalisiert Macbeth sie. Doch anstatt eine gesunde Form der Schuldverarbeitung zu finden, verliert er sich in Paranoia.
Macbeth handelt aus einem Ersatzbedürfnis: Er glaubt, dass Macht ihn vollständig machen kann. Doch als er sie erlangt, spürt er nicht das erwartete Gefühl der Sicherheit, sondern die Leere einer Position, die er nicht aus eigener Kraft verdient hat. Und genau das macht ihn verwundbar. Macbeth verdrängt seine Schuld nicht nur, er versucht, sie durch immer weitere Morde ungeschehen zu machen. Jeder Mord ist eine Schutzmaßnahme gegen sein eigenes Schuldgefühl. Doch die Schuld ist kein Feind, den man eliminieren kann – sie bleibt, wächst und frisst ihn schließlich auf.
🔹 Schuldmechanismus: Verdrängung durch Eskalation
🔹 Strategie: Kontrolle durch Eliminierung von Bedrohungen
🔹 Fallstrick: Schuld wächst exponentiell und wird zur Selbstauslöschung
Lear glaubt an eine romantisierte Form von Macht. Schon zu Beginn des Stücks äußert er diesen Irrglauben, als er seine Töchter auffordert, ihre Liebe zu ihm öffentlich zu erklären, um einen Teil des Reiches zu erhalten:
"Welch von euch, die wir am meisten lieben, dass sie das größte Teil unsres Reichs empfange?" (King Lear, Akt 1, Szene 1, Übersetzung von Frank Günther).
Er sieht Macht als eine Form von Ehre und Verehrung, nicht als eine Verantwortung mit realen Konsequenzen. Er sieht sich nicht als Strippenzieher, sondern als Vaterfigur, der Gnade walten lässt. Sein größter Fehler ist sein Irrglaube, dass Macht ohne Verantwortung existieren kann. Seine Entscheidung, das Reich aufzuteilen, ist der Ausdruck seines Wunsches, die Last der Herrschaft abzugeben, aber die damit verbundene Verehrung zu behalten.
Er wird zum Opfer seines eigenen Missverständnisses: Er erkennt zu spät, dass Macht nicht etwas ist, das man teilen oder verschenken kann, ohne Konsequenzen zu tragen. Als er realisiert, dass sein eigener Machtverlust ihn zur Marionette gemacht hat, zerbricht er. Er hat keine Schuldregulationsfähigkeit, weil er sich nie als jemand wahrgenommen hat, der Fehler machen kann. Erst als er alles verliert, sieht er seine eigene Verantwortung – doch da ist es zu spät.
🔹 Schuldmechanismus: Späte Einsicht durch Selbstverlust
🔹 Strategie: Delegation der Macht ohne strategische Weitsicht
🔹 Fallstrick: Fehlendes Verständnis für die Dynamik von Macht
Richard III. ist eine radikale Umkehrung von Lear. Während Lear Macht romantisiert, versteht Richard sie als Mechanismus, der ohne Moral funktioniert. Er sieht Schuld nicht als Belastung, sondern als Werkzeug: Wer sich schuldig fühlt, ist manipulierbar. Richard verwendet Schuld, um andere zu lenken – aber er selbst empfindet sie nicht.
Sein größtes Talent ist seine Fähigkeit, andere glauben zu machen, dass sie seine Taten legitimieren. Er stellt sich als Opfer dar, als missverstandene Figur, die nur nimmt, was ihm zusteht. Diese Form der narzisstischen Manipulation macht ihn äußerst effektiv, aber auch blind für seine eigenen Schwächen. Denn auch wenn er selbst keine Schuld empfindet – seine Umwelt tut es. Und am Ende sind es genau die Schuldgefühle derer, die er betrogen hat, die zu seinem Untergang führen.
🔹 Schuldmechanismus: Instrumentalisierung von Schuld bei anderen
🔹 Strategie: Manipulation durch Emotionalisierung und Opferrolle
🔹 Fallstrick: Überschätzung der eigenen Unangreifbarkeit
Was verbindet diese vier Herrscher? Sie alle stehen vor der gleichen Herausforderung:
Wie gehe ich mit der Last meiner Entscheidungen um?
Ihre Antworten darauf bestimmen ihr Schicksal:
✅ Heinrich V. rationalisiert sie und bleibt stabil, riskiert aber, sich selbst zu entfremden.
❌ Macbeth will sie töten – und wird selbst von ihr getötet.
❌ Lear ignoriert sie, bis sie ihn zerstört.
❌ Richard III. instrumentalisiert sie und wird Opfer seiner eigenen Manipulation.
Meine Schlussfolgerung aus Shakespeares Werken ist eine universelle:
Macht erfordert eine bewusste Schuldregulation. Wer Verantwortung trägt, aber keine Schuld anerkennen kann, wird entweder zynisch, wahnsinnig oder zerstört.
Aus meiner Sicht sind diese Mechanismen auch heute noch in der modernen Politik und Wirtschaft klar erkennbar. Ob autoritäre Herrscher, CEOs großer Unternehmen oder politische Entscheidungsträger – der Umgang mit Schuld und Verantwortung entscheidet oft über ihren langfristigen Erfolg oder Niedergang. Beispiele wie der unaufhaltsame Aufstieg und Fall von skrupellosen Konzernführern oder politischen Machthabern zeigen, dass Macht ohne reflektierte Schuldregulation immer in die Krise führt.
Die Frage bleibt also: Haben wir aus der Geschichte gelernt – oder wiederholen wir immer wieder die gleichen Muster? Wer Verantwortung trägt, aber keine Schuld anerkennen kann, wird entweder zynisch, wahnsinnig oder zerstört.**
Das gilt für Könige im Mittelalter – und für Führungskräfte heute. Was denken Sie? Wie erleben Sie den Umgang mit Macht und Schuld in der heutigen Zeit? Lassen Sie uns darüber diskutieren!