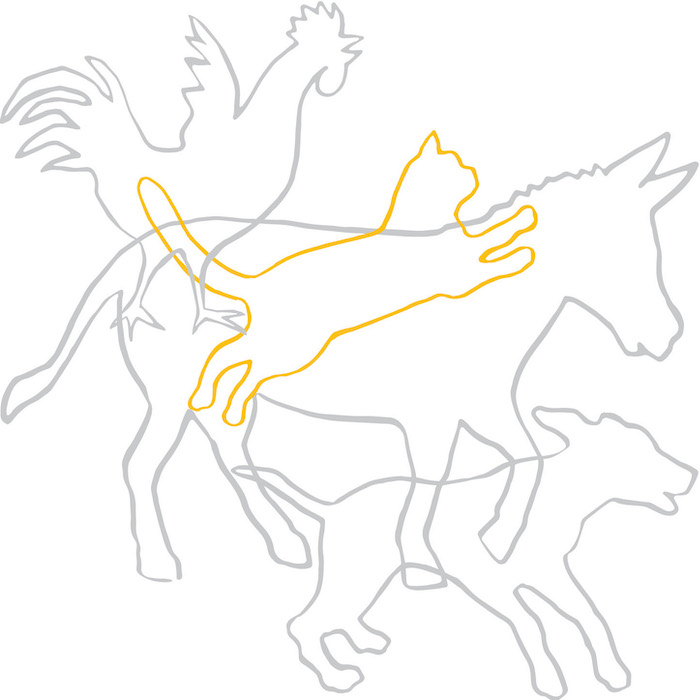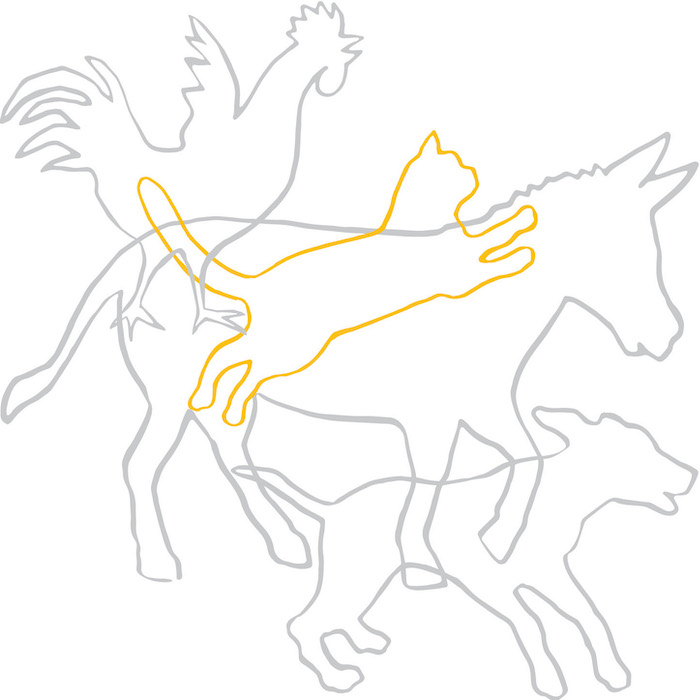Raphaela Dell
Mit einer Kombination aus Psychologie, Organisationslehre und Methoden aus der Welt der Kultur und der Philosophie, befähigt sie Menschen ihr Potential voll zu nutzen.
Mit einer Kombination aus Psychologie, Organisationslehre und Methoden aus der Welt der Kultur und der Philosophie, befähigt sie Menschen ihr Potential voll zu nutzen.
Interesse geweckt?
Schreib uns eine E-Mail, ruf uns an oder nutze einfach unser Kontaktformular.
Shakespeare hätte KI geliebt
„Shakespeare war so lange ein guter Autor, wie die Geschichte zuvor bereits von jemand anderem erzählt worden ist.“
Ein Satz, der dem großen George Bernard Shaw zugeschrieben wird, und der einem Genie wie Shakespeare zugleich den Glanz wie auch den Staub der Diebeskunst bescheinigt. Shakespeare, der Literatur-Pirat, der Rabe der Renaissance. Ein Mann, der – und das lässt sich nicht schönreden – abgeschrieben, „geborgt“ und geklaut hat, wie es sich gehört, wenn das Copyright noch nicht in Sichtweite ist. Aber genau das macht ihn so modern. Denn seien wir ehrlich: Hätte Shakespeare heute gelebt, wäre er der König der KI-Prompter gewesen.
Shakespeare: Der Vorläufer der Copy-Paste-Kunst
Shakespeare hat nichts aus dem Nichts erschaffen. Seine Stücke lesen sich wie das Best-of von antiken Stoffen, mittelalterlichen Chroniken, und, seien wir großherzig, den besseren Ideen seiner Zeitgenossen. „Hamlet“? Ein alter Stoff aus Skandinavien. „Romeo und Julia“? Schon lange vor ihm erzählt, etwa von Matteo Bandello. „King Lear“? Ein Märchen aus dem tiefen Fundus der keltischen Sagenwelt. Aber was Shakespeare auszeichnet, ist die Fähigkeit, Rohmaterial zu veredeln, Geschichten zu destillieren, bis sie goldene Dramatik tröpfeln.
Man stelle sich vor: Shakespeare sitzt in seinem dunklen Arbeitszimmer – vermutlich zwischen Stapeln von Pergamenten – und hätte Zugriff auf ChatGPT oder irgendeine moderne KI. Sein Prompt?
„Gib mir eine tragische Liebesgeschichte zwischen zwei verfeindeten Familien, ich brauche viel Pathos, ein gutes Ende kommt mir nicht ins Haus, und die Dialoge müssen sitzen wie ein Dolchstoß ins Herz.“
Und voilà: Romeo und Julia wären mit Sicherheit noch schneller aus der Feder geflossen, diesmal vielleicht in zwölf statt fünf Akten. KI als Co-Intelligenz? Shakespeare hätte sie sich geangelt, wie er alles geangelt hat, was seine Stücke aufwertete. Warum? Weil er wusste, dass ein guter Autor klauen muss – und die besten Autoren klug klauen.
Königsdramen: Shakespeares „Soap-Opera“
Nicht nur das: Shakespeare war der Erfinder der historischen Soap-Opera. „Heinrich IV“, „Richard III“, „Heinrich VI“ – das sind Serien-Dramen in Reinkultur, bei denen jede Figur ihr Schicksal ausreizt, bis die Bühne zum Schlachtfeld wird. Wer stirbt? Wer lebt? Welche Intrige kippt die Machtverhältnisse? Cliffhanger galore. Hätte Netflix die Rechte gehabt, Shakespeares Königsdramen wären heute Bestseller-Serien.
Und Shakespeare? Er hätte ein Autorenpool angeführt. Ja, er wäre ein „Soapy“ gewesen. Wie jeder gute Showrunner hätte er seine Autoren per KI koordinieren lassen: „Schreibt mir einen Konflikt zwischen Vater und Sohn, der zum Brudermord führt, und würzt das Ganze mit einer Prise römischen Pathos!“ Und schon hätten KI und Shakespeare gemeinsam die nächste Serie kreiert – „Das Haus Plantagenet: Blut, Macht und Misstrauen“.
Halluzinieren wie eine KI
Aber der Barde war nicht perfekt. Wer die Kirchturmglocken im alten Rom läuten hört, der weiß: Shakespeare halluzinierte. Wie heute eine KI, die manchmal Elefanten Flügel verleiht, brauchte auch er gelegentlich ein paar kreative Lückenfüller. Hauptsache, die Story saß. Detailgenauigkeit? Pah. Was zählen schon historische Fehler, wenn das Publikum bei „Julius Caesar“ in Scharen applaudiert? Shakespeare vergaß, nachzuschlagen, ob Glocken zu Caesars Zeiten existierten. Aber es funktionierte trotzdem. So wie die KI manchmal schneller „dichtet“ als recherchiert, weil die Poesie Vorrang hat.
Der kluge Prompter
Shakespeare wäre nicht nur Nutzer der KI gewesen – er wäre der klügste Prompter seiner Zeit gewesen. Denn was KI heute wie damals gebraucht hätte, ist ein Mensch, der weiß, wie man sie füttert. Shakespeare wusste zu viel. Über Handel, über Zünfte, über Politik, über menschliche Abgründe, die wir in seinen Stücken so leidenschaftlich finden. Er war wie ein Drehbuchautor, der Recherche betreibt, weil er weiß: Je mehr er einfließen lässt, desto lebendiger wird das Stück. Shakespeare hätte die KI genutzt, um sich Inspiration zu ziehen, Fakten zu schärfen – oder sie, ach was soll's, zu ignorieren.
Shakespeare hätte KI geliebt
Denn am Ende geht es um eines: gute Geschichten. Shakespeare hat sie geliefert – mit oder ohne Glockenturm im falschen Jahrhundert. Er hätte die KI umarmt wie einen neuen, witzigen Lehrling. Zusammen hätten sie vielleicht noch mehr Stücke produziert – witziger, tragischer, tödlicher.
Und hätte die KI ihm etwas zu stumpf die Antwort geliefert? Nun, er hätte gepromptet, bis der Wortschatz floss wie das Blut seiner Helden.
„Ein Königreich für ein Pferd?“ Vielleicht hätte die KI Shakespeares Zeilen sogar einen Twist gegeben: „Ein Königreich für ein Self-Driving Horse.“ Shakespeare hätte sich gekugelt vor Lachen – und schon das nächste Stück begonnen.
Denn eines ist sicher: Der Meister der Worte hätte die KI nicht als Konkurrentin gesehen, sondern als Muse. Denn egal, ob damals oder heute – Shakespeare wusste: Der Stoff ist überall, man muss ihn nur ergreifen.
Und wenn die KI heute träumt, halluziniert und dichtet – dann steht der Geist Shakespeares daneben und applaudiert: „So gefällst du mir, du digitale Co-Dichterin.“